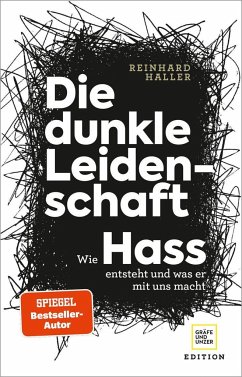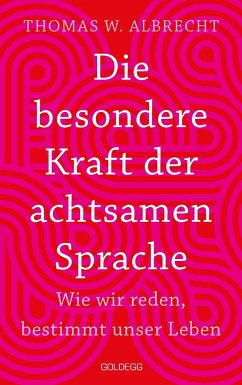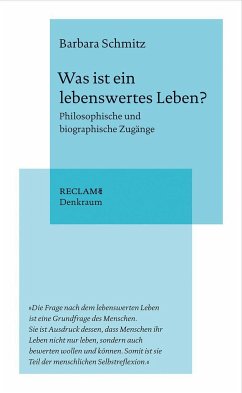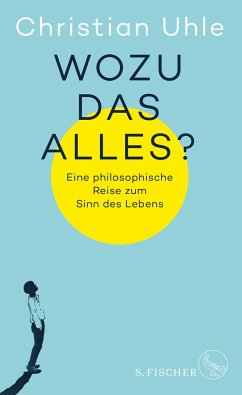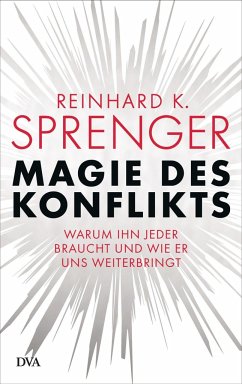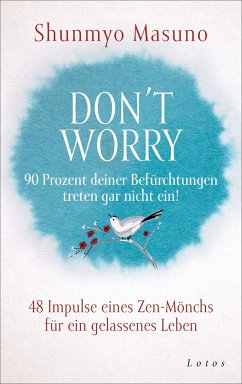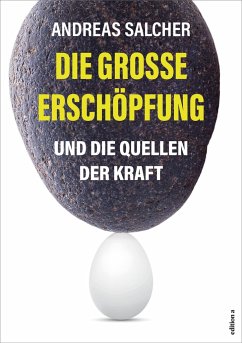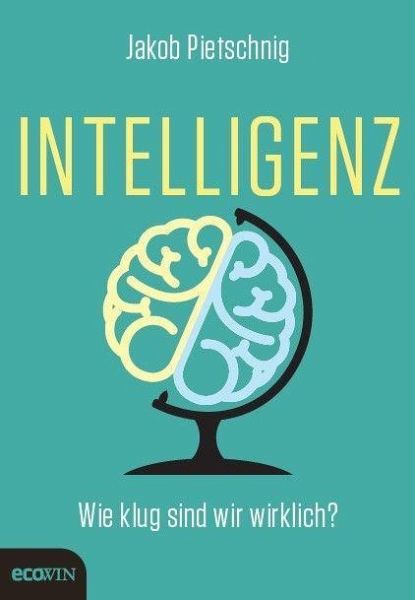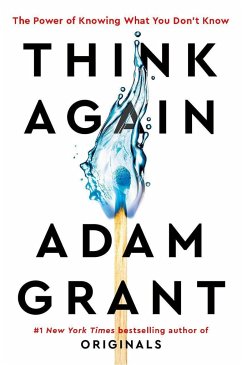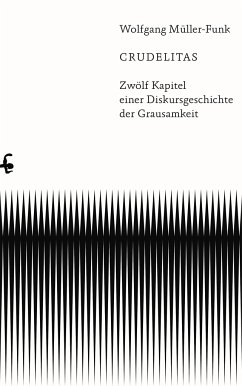Im Gehirn gibt es Areale für Hassgefühle
Reinhard Haller möchte wissen welche Erkenntnisse die Neurowissenschaften zu den Grundlagen des Hasses erbringen können. Möglicherweise ist das menschliche Gehirn jedoch niemals in der Lage, sich selbst ganz zu begreifen. Obwohl das Gehirn 100 Milliarden Nervenzellen, 5,8 Kilometer an Nervenbahnen und seiner über die Trillionengrenze hinausreichende Zahl an Schaltstellen besitzt. Weil die Hirnforschung aber heute nachweisen kann, welche Teile des Gehirns unter welchen Bedingungen aktiviert werden, müsste es möglich sein, dort Repräsentationen für den Hass zu finden. In der Tat gibt es einige interessante Ergebnisse: So konnte aufgezeigt werden, welche…
Read More