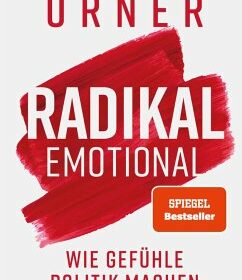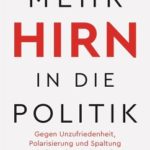Man sollte sich seiner Vorurteile entledigen
Charles Pépin schreibt: „Begegnung ist auch dies: ein Zunichtemachen unserer Repräsentationen, unserer vorgefasste Meinungen zur Welt und zu den Lebewesen durch die Wirklichkeit.“ Der Zustand der Bereitschaft erfordert also auch, dass man seine Erwartungen lockert, seine Kriterien und Vorurteile aufweicht. Letztere verengen gleich Scheuklappen des Blickfeld und hindern einen Menschen, in Erwägung zu ziehen, was ihn glücklich machen könnte. Man sollte sich seiner Vorbehalte entledigen, seine Überfügungen und Gewissheiten infrage zu stellen. Wie oft verwechselt man überstürzte Urteile, die nach einer schlechten Erfahrung auf der Außenhaut des eigenen Geistes deponiert werden, konformistische Gedanken und verformte Widerklänge einer gehörten Geschichte mit authentischen Überzeugungen. Diese bröckeligen Meinungen zu entlarven und darüber hinaus imstande zu sein, die eigenen Gewissheiten gegen Zweifel einzutauschen, darin liegt das Geheimnis der Bereitschaft. Charles Pépin ist Schriftsteller und unterrichtet Philosophie. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.
Eine Form des Skeptizismus ist die Fähigkeit „nicht zu wissen“
Die Bereitschaft impliziert eine Form des Skeptizismus im erhabenen Sinn des Wortes, wie er in der antiken Philosophie definiert wird: die Fähigkeit, „nicht zu wissen“. Charles Pépin erklärt: „Wenn ich weiß, dass eine Frau, die sich Kinder wünscht, mich nicht glücklich machen kann, bin ich für eine mögliche Liebesgeschichte mit ihr nicht offen. Wenn ich aber skeptisch bin, also nicht weiß, ob diese Frau für mich gemacht ist oder nicht, muss ich auf sie zugehen.“ Das Wort „skeptisch“ kommt vom griechischen „skeptikós“ – Betrachter.
Es verweist übrigens nicht so sehr auf den Begriff des Zweifels als vielmehr auf die „Zurückhaltung des Urteils“, dem eigentlichen Gedankenhorizont der ersten skeptischen Gelehrten wie Pyrrhon von Elis oder Sextus Empiricus. Charles Pépin erläutert: „Ihr existenzieller Vorschlag ist radikal, hat aber eine befreiende Wirkung: Man begreift, dass man zu der einen oder zu der anderen Seite tendieren könnte, dabei betrachtet man die Argumente und beleuchtet die Widersprüche und Ungewissheiten.
Begegnungen können Überraschungen bereit halten
Aber man bleibt in der Schwebe und weigert sich, dem Prinzip der „Ununterscheidbarkeit“ folgend, Stellung zu beziehen. Man hält sich mit seinem Urteil zurück. Charles Pépin schlägt ein kleines Gedankenexperiment vor: „Lassen wir unsere Fantasie spielen. Wir haben äußerst konkrete Erwartungen und visualisieren ganz detailliert die Person, wie wir uns wünschen: ihr Aussehen, ihre Größe, ihren Blick, ihren Beruf, ihre Reaktionen, ihre Art zu denken, zu sprechen, zu lieben.“
Das Schicksal lächelt uns weit über alle realistischen Erwartungen hinauf zu und setzt uns die perfekte Verkörperung unserer Träume vor – was in Wirklichkeit natürlich unmöglich ist. Können wir noch von Begegnung sprechen? Wird das völlige Fehlen eines Überraschungsmoments nicht alles tilgen, bis hin zum Gefühl, jemanden getroffen zu haben? Nun wird verständlicher, welche Resonanz der so simple Satz wie „Ich habe jemanden getroffen“ hat, den wir einem Freund, einer Cousine, einem Psychoanalytiker leise anvertrauen. Er sagt eigentlich aus: „Ich bin jemandem begegnet, der mich überrascht hat“, der meine Erwartungen unterläuft, und das gefällt mir. Quelle: „Kleine Philosophie der Begegnung“ von Charles Pépin
Von Hans Klumbies