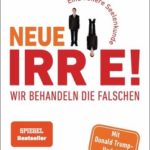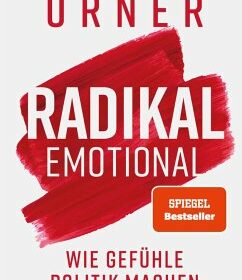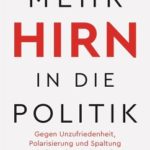C. G. Jung lehnt die Theorie vom Ödipuskomplex ab
C. G. Jung schloss sich 1907 mit großem Enthusiasmus der Psychoanalyse Sigmund Freuds an. C.G. Jung stand unter dem Einfluss romantischen und religiösen Schriften und versuchte diese geistigen Strömungen in seine psychoanalytische Theorie und Praxis einzuarbeiten. Eine erste Abgrenzung zur Psychoanalyse Sigmund Freuds vollzog er mit dem Buch „Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie“, das 1912 erschien.
C. G. Jung versteht unter Libido die Lebensenergie
Eine noch deutlichere Trennung vollzog er mit dem Werk „Wandlungen und Symbole der Libido“ von 1912/13. C. G. Jung stieß sich beispielsweise am Begriff der Libido, der nur für das sexuelle Verlangen stehen sollte. Er verstand unter der Libido die Lebensenergie überhaupt. Diese Lebenskraft, die dem Menschen Schwung verleiht, äußert sich seiner Meinung nach im Nahrungs- und Sexualtrieb, aber auch in ganz ursprünglichen seelischen und geistigen Bedürfnissen, die aber nicht als Sublimationsprodukt sexueller Energien angesehen werden dürfen. Die Ablehnung der universellen Sexualmotivation des Menschen spalte die Psychoanalyse in rivalisierende Gruppen.
Die Theorie vom Ödipuskomplex lehnte C. G. Jung ebenfalls ab. Sie besagt, dass jedes Kind notwendigerweise den andersgeschlechtlichen Elternteil begehren und den Elternteil vom gleichen Geschlecht in einer bestimmten Phase der Entwicklung hassen muss. C. G. Jung war der Meinung, dass sich diese Theorie nur bewahrheite, wenn das Kind in der Erziehung verwöhnt wird, woran die Erwachsenen die Hauptschuld tragen, da sie das Kind zu sehr an sich binden möchten. C. G. Jung bestritt auch, dass ein erwachsener Neurotiker immer noch Sex mit seiner Mutter haben möchte. Sie sei nur das Symbol für das Unmögliche, für die Rückkehr ins unverantwortliche und mühelose Kinderleben, wonach sich der neurotische Patient zu sehnen pflegt.
Die Träume sind ein seelisches Naturphänomen
Nach Sigmund Freud war im Seelenleben des Menschen alles und jedes streng determiniert, er wandte das Kausalitätsprinzip der Naturforschung auch in der Seelenkunde an. C. G. Jung wollte, ähnlich wie Alfred Adler, die Kausalität durch die Finalität ergänzen. Für ihn war Seelisches nicht nur durch Ursachen bedingt, sondern auch durch Ziele, Zwecke und Werte. Man könne die Seele eher durch das begreifen, wohin sie strebt, als durch das, woher sie kommt. C. G. Jung erkennt im Gegensatz zu Sigmund Freud die schöpferischen Kräfte im Leben der Seele.
Die Träume sieht C. G. Jung als ein seelisches Naturphänomen an und zeigen für C. . Jung nicht nur die Regungen des individuellen Unbewussten, sondern in ihren Tiefenschichten äußert sich auch das kollektive Unbewusste der Menschheit. C. G. Jung vertrat die Auffassung, dass eine Neurose in den Bereichen der Liebe, der Arbeit oder der Sinnfindung auftreten kann. Daher sei es notwenig, einen Neurotiker nicht nur zu analysieren, sondern auch zu erziehen und moralisch zu fördern.
Von Hans Klumbies