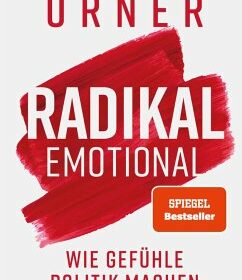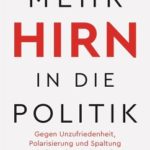Selbstverwirklichung liegt voll im Trend
Manche Menschen haben das Ziel, möglichst alle Potenziale, die in ihnen schlummern, zu mobilisieren und ihnen zur Entfaltung zu verhelfen. Der Maßstab dieses Lebensstils ist die größtmögliche Fülle des Lebens. Andreas Reckwitz warnt: „Die Kehrseite der Selbstentgrenzung ist die Selbstüberforderung. Die Chance zum Neuen und Anderen kann sich in den Selbstzwang zum Neuen und Anderen verkehren, in eine Selbstransformation um ihrer selbst willen, aus der sich keine zusätzliche Befriedigung mehr ergibt.“ Idealerweise soll hier immer alles Wünschbare zugleich verwirklicht sein: Karriere und Familie, lokale Verankerung und globale Weite, Abenteuer und Verlässlichkeit und so weiter. Der Verzicht auf einzelne dieser Möglichkeiten erscheint dann als grundsätzlich negativ konnotiert. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Die neue Mittelklasse strebt nach erfolgreicher Selbstverwirklichung
In dem spätmodernen Selbstverwirklichungsimperativ ist eine Verzichtsaversion eingebaut. Auch die Beurteilung durch andere – oft im beruflichen oder privaten Kontext – kann Selbstransformationsfähigkeit entsprechend zu einer Leistungsanforderung werden. Andreas Reckwitz erklärt: „Wer sich mit dem einmal Gefundenen begnügt, gilt rasch als selbstzufrieden borniert und nicht hinreichend aufgeschlossen. Es wird damit ein weiteres Mal deutlich: Der Wert, welcher der Einzigartigkeit des Subjekts in der spätmodernen Kultur zugeschrieben wird, gilt keineswegs bedingungslos.“
Zwar mag die singularistische Subjektkultur eine Vielzahl verschiedener Interessen, Begabungen und Lebenswege tolerieren und ermutigen – der Radius des Möglichen markiert aber trotzdem Grenzen des wertvoll Singulären. Andreas Reckwitz erläutert: „Insbesondere das unbewegliche, das im weitesten Sinne immobile Subjekt, verstanden als ein Selbst, dem es in seiner Persönlichkeitsstruktur an „Offenheit“ mangelt, bildet hier eine negativ bewertete Gegenfigur zum kreativen Subjekt.“ Die anspruchsvolle Lebensführung der erfolgreichen Selbstverwirklichung, wie sie die neue Mittelklasse verfolgt, ist aus systematischen Gründen enttäuschungsanfällig.
Der Arbeitsmarkt ist unberechenbar geworden
Andreas Reckwitz weiß: „Enttäuschung heißt generell: subjektive Erwartungen bleiben unerfüllt, was negative Emotionen – von Selbstvorwürfen bis zur Wut – zur Folge hat.“ Pauschal kann man feststellen: Die klassische, industrielle Moderne war angetreten, subjektive Enttäuschungen über das System der Berechenbarkeit ihrer Institutionen zu minimieren. Indem staatliche und ökonomische Prozesse und letztlich auch die privaten Lebensformen planbar gemacht wurden, sollten subjektive Erwartungen in der Regel erfüllt werden. Dies mag tatsächlich der Fall gewesen sein – zumindest in punkto Lebensstandard.
Die Verheißung des Fortschritts der klassischen Moderne war in dieser Hinsicht ein Programm zur Vermeidung von Enttäuschungen. Andreas Reckwitz stellt fest: „Die Kultur der Spätmoderne erweist sich demgegenüber als ein struktureller Enttäuschungsgenerator – und dies betrifft auch die akademische Mittelklasse, gleichwohl sie in ihrer mitlaufenden Statusinvestition Planungssicherheit herzustellen versucht.“ Insbesondere der Arbeitsmarkt ist in der Wissens- und Kulturökonomie im Verhältnis zur Industrieökonomie unberechenbarer geworden. Quelle: „Die Gesellschaft der Singularitäten“ von Andreas Reckwitz
Von Hans Klumbies