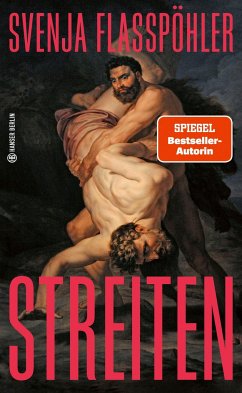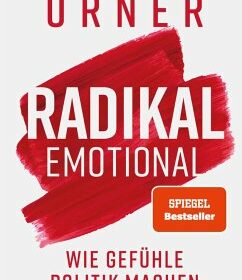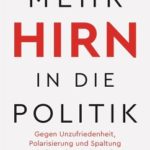Der Streit ist kein Diskurs
Svenja Flasspöhler schreibt: „Zunächst einmal gilt zu klären, worüber wir reden, wenn wir von „Streit“ reden. Dies umso mehr, als die Ermahnung, wir müssten wieder lernen zu streiten, dieser Tage so oft zu hören ist, dass sie in meinen Ohren schon wieder ein wenig wohlfeil klingt. Streit, da schwingt so herrlich mit, was und doch allen lieb und teuer ist.“ Wer streiten kann, setzt sich mit Andersdenkenden auseinander, hält die Meinungsfreiheit hoch. Wie sagte Ex-Kanzler Helmut Schmidt: „Eine Demokratie in der nicht gestritten wird, ist keine.“ Ein Satz, den sich eine große Wochenzeitung zu eigen gemacht hat, um ihre Rubrik „Streit“ zu bewerben, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Svenja Flasspöhler ist promovierte Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie Magazins.
Der Streit ist nie harmlos
Streitens, so scheinst es, ist etwas Gutes, zumindest dann, bestimmte Benimmegeln berücksichtigt werden. Das ist alles nicht falsch und verfehlt doch das Spezifische das Phänomens. Svenja Flasspöhler betont: „Über das Streiten nachdenken heißt, sich von Illusionen zu betreiben. Der Streit ist nie harmlos. Der Abgrund der Vernichtung ist immer da. Bereits die Begriffsgeschichte weist eindrücklich auf Gewalt dieses Tuns hin, und war wohlgemerkt: eine physische Gewalt.
Vor zwei Jahrhunderts hieß streiten vor vornehmlich: kämpfen. Und zwar buchstäblich aufs Blut. Svenja Flasspöhler erklärt: „In unserer Zeit weisen Ausdrücke und Redewendungen wie „Schlagabtausch“ oder „Wortgefecht“ noch auf diese körperliche Dimension hin, die als Möglichkeit immer lauert.“ Wer „einen Streit vom Zaun bricht“, lässt einen Streit so heftig und plötzlich eskalieren, „wie man eine Latte – als Waffe – von nächsten Umzäunung bricht.“ Das Streit hat immer das Potenzial, in reale, physische Gewalt umzuschlagen.
Streiten hat einem Perspektivwechsel nichts zu tun
Eingedenk dieser Eskalatonispotenz zeugt der heutige Wortgebrauch von „Streiten“ dennoch von zunehmenden Pazifizierung moderner Gesellschaften. Genauer: von einem Prozess zivilisatorischer Sensibilisierung, der körperliche Gewalt einzudämmen und sprachlichem Aushandlungen und an ihre Stelle zu versucht. Wenn wir vor „Streiten“, meinen wir keinen Waffenkampf um Leben und Tod mehr. Wer „streitet“, kämpft nicht physisch, sondern verbal, und zwar am bestens fair, sachlich und lösungsorientient, getragen eigensteigenden Verstehen, der Fähigkeit zum Perspektivwechsel.
Womit wir allerdings sogleich bei der problematischen Aufweichung der Begriffs – und zwar im doppeltem Sinne – angelangt wären. Svenja Flasspöhler weiß: „Wer nämlich meint, es sei möglich, sich emphatisch und verständnisvoll zu streiten, hat noch nicht erfasst, was Streit ist.“ Streiten hat mit einem Perspektivwechsel, einem Aus-sich-Heraustreten, zunächst einmal nichts zu tun. Ein Mensch, der anfängt, den Gegenstand des Streits mit den Augen des anderen mit zu sehen, streitet schon nicht, sondern befindet sich bereits auf der Weg der Verständigung. Quelle: „Streiten“ von Svenja Flasspöhler
Von Hans Klumbies