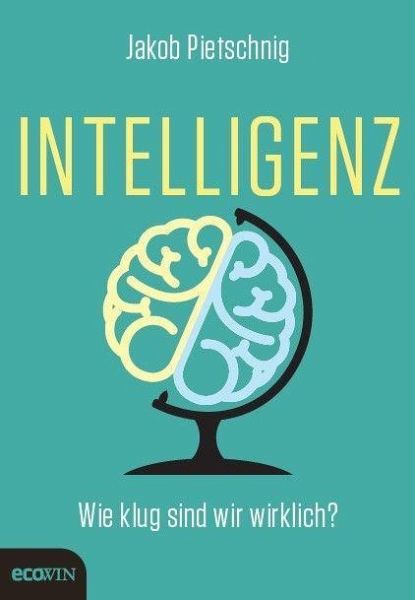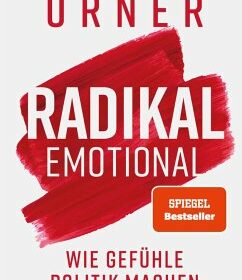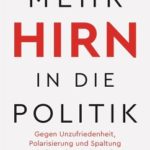Entwicklungstests sind keine Intelligenztests
Mitunter haben es auch Kinder nicht ganz leicht, vor allem Erstgeborene. Jakob Pietschnig weiß noch gut, mit welcher Besorgnis er jeden einzelnen Entwicklungsschritt seines Sohnes registrierte: „Die Ergebnisse ärztlicher Routineuntersuchungen ließen nichts zu wünschen übrig, sie gaben jedoch keinerlei Aufschluss über seine kognitiven Fähigkeiten.“ Deshalb entschied sich Jakob Pietschnig mit seinem zweijährigen Sohn eine Entwicklungstest zu machen. Entwicklungstests unterscheiden sich in einigen Punkten von Intelligenztests. Unter anderem erfassen sie neben Aspekten der psychischen Entwicklung auch solche der physischen. In der Regel sind die zu erfüllenden Aufgaben abwechslungsreich, wenn nicht sogar spannen. Andernfalls könnte man Kleinkinder wohl auch nicht zum Mitmachen motivieren. Bevor man ein Kind testet, sollten zwei Bedingungen erfüllt sein. Jakob Pietschnig lehrt Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik an der Universität Wien.
Eltern sollten einen Test bei ihren Kindern keinesfalls selbst durchführen
Es sollte ein konkreter Grund für die Testung vorliegen, abgesehen von dem reinen elterlichen Interesse. Und Eltern sollten einen Test bei ihren Kindern keinesfalls selbst durchführen, selbst wenn sie dafür qualifiziert sind. Jakob Pietschnig streut sich Asche auf sein Haupt: „Das wusste ich zwar schon, bevor ich den Test mit meinem Sohn gemacht habe, allerdings hätte mir das vermutlich nochmals jemand sagen sollen.“ Zumindest hat Jakob Pietschnig die Chance bekommen, diesen Fehler nicht noch einmal zu machen.
Als Nachgeborene darf sich seine Tochter darüber freuen, dass man als Elternteil der kindlichen Entwicklung beim zweiten Kind etwas entspannter gegenübersteht. Generell ist festzuhalten, dass insbesondere beim Übertritt vom Kindergarten in die Schule Empfehlungen aus der psychologischen Einschulungsdiagnostik ganz außerordentlich gewinnbringend für den weiteren Bildungsverlauf sein können. Die Frage, ob ein Kind eingeschult werden soll oder nicht, ist mitunter eine schwierige.
Viele Eltern vermuten eine Hochbegabung bei ihrem Kind
Typischerweise werden Kinder, die kleiner oder größere Defizite haben, für ein Jahr zurückgestellt, besuchen eine Vorschule und werden anschließend eingeschult. Und das ist auch wichtig, denn in Vorschulen steht die Förderung der schulischen Kompetenzen der Kinder im Vordergrund. Trotzdem ist die implizite Annahme bei der Rückstellung doch die, dass die bestehenden Defizite verschwinden, wenn man nur genug Zeit vergehen lässt. Als grundlegendster Wandel in der Lehrmeinung zu diesen Einschulungsfragen hat sich aber der Zugang zur Rückstellung im Allgemeinen gezeigt.
Jakob Pietschnig erläutert: „Anstatt ein Kind einfach ein Jahr später einzuschulen, ist es bei punktuellen Defiziten in vielen Fällen sinnvoll, das Kind nicht zurückzustellen. Aber begleitend zur Einschulung müssen dann in weiterer Folge diese Kinder gezielt gefördert werden, um die Defizite beseitigen zu können.“ Tatsächlich wird ein nicht unbeträchtlicher Teil der Eltern, nicht deswegen vorstellig, weil sie Defizite vermuten, sondern weil sie wissen wollen, ob die Kinder hochbegabt sind. Quelle: „Intelligenz“ von Jakob Pietschnig
Von Hans Klumbies