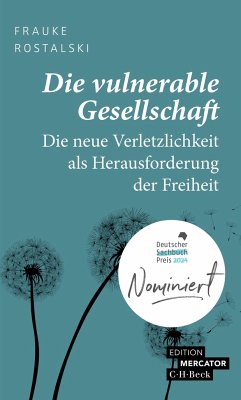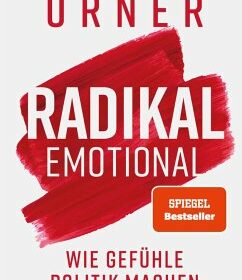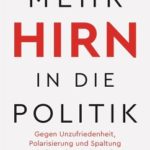Resilienz erhöht die Widerstandskraft
Resilienz kann nicht nur dazu beitragen, dass bei der Konfrontation mit Belastungen psychische Störungen vermieden werden. Frauke Rostalski fügt hinzu: „Darüber hinaus kann sie bewirken, dass „Wendepunkte“ erst gar nicht eintreten, indem sich das Individuum kontinuierlich an die Änderungen äußerer und innerer Lebensbedingungen anpasst. Zudem erhöhen Resilienzerfahrungen selbst die psychische Widerstandskraft, indem sie das Selbstwertgefühl steigern.“ Die Förderung von Resilienz lässt sich daher als Antwort auf Vulnerabilität verstehen. Verletzlichkeit kann vermieden, gelindert oder zumindest so kompensiert werden, dass sie keinen maßgeblichen Einfluss auf die Autonomie und Teilhabemöglichkeit des Menschen hat. Hierzu trägt die Stärkung jener Faktoren bei, die Resilienz begründen. Während Vulnerabilität sämtliche Merkmale umschreibt, die eine Person in einer Situation mit hohen Anforderungen schwächen, umfasst Resilient alles Stärkende. Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie, Wirtschaftsrecht, Medizinstrafrecht und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln.
Der Mensch ist seinem Gegenüber ausgesetzt
Psychologische und psychotherapeutische Interventionen zielen daher darauf ab, Vulnerabilität abzumildern, und zwar insbesondere, indem Resilienz gestärkt wird. Frauke Rostalski erklärt: „Dabei geht es nicht darum, die Verletzlichkeit als Conditio humana auszublenden, wohl aber Lebensbedingungen zu fördern, die den Einzelnen zur Resilienz befähigen.“ Was aber macht die Verletzlichkeit zur einer conditio humana? Besonders ausdrücklich lassen sich hierzu Antworten bei Emmanuel Lévinas finden, der menschliches „Sein als Verwundbarkeit“ versteht.
Der Mensch bezeichne sich durch „Verwundbarkeit, dem Leiden ausgesetzt sein, Sensibilität, Passivität.“ Frauke Rostalski weiß: „Emmanuel Lévinas begründet die Verwundbarkeit des Menschen mit dessen Nähe zu anderen. Der Mensch sei seinem Gegenüber ausgesetzt. Daraus ergebe sich eine doppelte Angriffsfläche.“ Für Lévinas liegt der Schwerpunkt der menschlichen Verletzlichkeit nicht in der Möglichkeit, selbst Opfer von Angriffen zu werden, sondern darin, das Leiden des anderen als eigenen Schmerz zu empfinden.
Bei Emmanuel Lévinas steht der leidende Mensch im Zentrum
In seiner Sensibilität sei der Mensch nämlich durchlässig für das Schicksal seines Gegenübers. Emmanuel Lévinas schreibt: „Die Ausgesetztheit gegenüber dem Anderen ist ein Sich-vom-Sein-Lösen – Nähe, Besessenheit durch den Nächsten; Besessenheit wider Willen, das heißt Schmerz.“ Bei Lévinas begegnet man also einer Anthropologie, in deren Zentrum der leidende Mensch steht. Subjektivität „meint Leiden am Leiden“. „Subjektivität ist Verwundbarkeit, die Subjektivität ist Sensibilität.“
Frauke Rostalski stellt fest: „Der leidende Mensch im Sinne von Lévinas ist hochsensibel gegenüber den eigenen Empfindungen und denen der anderen – so sensibel, dass das Leiden der anderen zu einem „Leiden in mir“ wird.“ Das gesamte Sein des Menschen kreist um dieses Motiv. Dabei steigert Emmanuel Lévinas die Sensibilität des Menschen so weit, dass er sie nicht bloß auf das unmittelbare Gegenüber ausdehnt, sondern gar auf „alle anderen“. Der Verhältnis zum anderen sei „das zu einem absolut Schwachen“. Quelle: „Die vulnerable Gesellschaft“ von Frauke Rostalski
Von Hans Klumbies