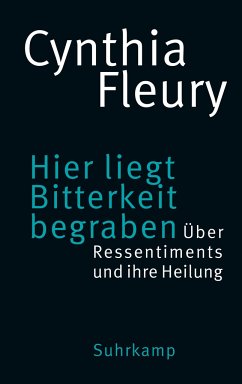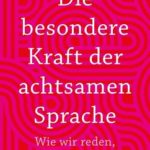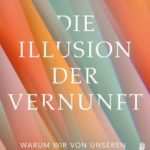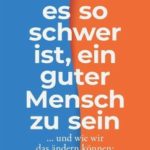Das Ressentiment ist ein tödliches Gift
Die Ablehnung von Gewalt kommt nicht nur den „Schwachen“ zu, sondern ist auch eine Seelenfestigkeit, die auf jeden Fall anzustreben ist. Cynthia Fleury ergänzt: „Im Übrigen kann jeder anhand der Geschichte und Gegenwart bestätigen, dass diejenigen, die zur Feindschaft unfähig sind, dies in der Regel nur konjunkturell sind und dass die Feindschaft bei der geringsten Möglichkeit, sie auszudrücken, ohne den Preis dafür zu zahlen, wieder ausbricht.“ Man muss also wachsam bleiben. Das Ressentiment ist ein umso tödlicheres Gift, als es mit der Zeit wächst und tief in die Herzen der Menschen eindringt. Die Liebe ist, wie Max Scheler in Erinnerung ruft, nach christlichem Verständnis ein Akt des Geistes und nicht des Empfindens, anders gesagt, ein Akt der Entscheidung, des Pflicht- und Verantwortungsgefühls. Die Philosophin und Psychoanalytikerin Cynthia Fleury ist unter anderem Professorin für Geisteswissenschaften und Gesundheit am Conservatoire National des Arts et Métiers in Paris.
Pathologien sind stark in bestimmte Epochen eingebettet
Der Umstand, dass Frauen laut Max Scheler der Gefahr des Ressentiments stärker ausgesetzt sind, ist nicht essentialistisch zu verstehen. Es spiegelt vielmehr die patriarchale Struktur wider, in die Frauen eingebunden oder in der sie vielfach gefangen sind. Cynthia Fleury stellt fest: „Der Groll ist die Waffe der Schwachen; die üble Nachrede ist die einfachste Art, sprachliche Performativität zu erzeugen, umso mehr, als das Handeln entzogen ist.“ Max Schelers etwas ranziger Konservatismus muss ebenso wie sein Antisemitismus dekonstruiert werden.
Seine Ode an die „rein weibliche“ Frau wird vielleicht diejenigen entzücken, welche die emanzipatorische und feministische Moderne verurteilen. Cynthia Fleury betont: „Hier hat sie das Verdienst, zu zeigen, dass eine oft zutreffende Beschreibung des Ressentiments uns nicht unbedingt vor unserem eigenen Ressentiment schützt und dass die Arbeit der Dekonstruktion immer zuerst bei einem selbst zu leisten ist.“ Abgesehen davon ist es gut, sich in Erinnerung zu rufen, wie sehr Pathologien in Epochen eingebettet und schwer teilbar sind, auch wenn manche von ihnen auf persönlichen Faktoren beruhen.
Hysterien verweisen auf ein egalitäres Schicksal der Unterwerfung
Nehmen wir die Hysterie. Diese wurde lange Zeit feminisiert, obwohl sie vor allem eine bestimmte Konditionierung widerspiegelt, die der Frau auferlegt wurde. Cynthia Fleury erläutert: „Die Reduzierung ihrer Welt, die Beschränkung auf das Private und Kleine, der Hausarrest, das Verbot der weiten Welt und der Selbsterweiterung.“ Im klinischen Bereich sind heute die Hysterien, wenn sie in den demokratischen Gesellschaften bestehen bleiben, ebenso männlich wie weiblich, da sie – leider – auf ein eher egalitäres Schicksal in der Unterwerfung verweisen.
Cynthia Fleury hätte sich gewünscht, dass die Unterwerfung in unseren sogenannten modernen Gesellschaften an Boden verliert, was sie in mancher Hinsicht auch getan hat, doch hat sie dabei ihren Wirkungskreis vergrößert un die Männer konsequenter einbezogen. Es sind die Deklassierten, diejenigen, der verächtlich als „Überzählige“ oder „Schmarotzer“ bezeichnet werden, diejenigen, die „hatten“, oder nur das Gefühl hatten, „gehabt“ zu haben, und die nun nur noch den Verlust konstatieren. Quelle: „Hier liegt Bitterkeit gegraben“ von Cynthia Fleury
Von Hans Klumbies