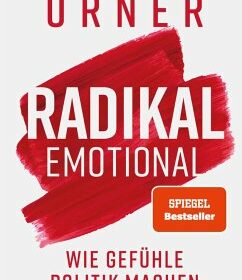Selbst die Empathie birgt tiefe Abgründe
Die Empathie, der man in der Gegenwart wieder ein so hoher Stellenwert zumisst, trägt bei aller Progressivität auch ein problematisches Potenzial in sich. Svenja Flaßpöhler betont: „Es ist richtig und wichtig, das Leiden von Betroffenen nachzuempfinden, mit ihnen mitzufühlen. Nur so erfährt erlittenes Unrecht Anerkennung. Doch ist die reine Empfindung noch keine Moral.“ Nichts kann einen Menschen von der Notwendigkeit des Urteils und der damit einhergehenden Distanzierung entbinden. Denn nicht alles, was man nachempfinden kann, verdient Solidarität und Anerkennung. Als Gefühl birgt die Empathie selbst tiefe Abgründe. Ihre dunkle Seite ist der Lustgewinn, der sich aus fremdem Leid ziehen lässt. Diese Seite zeigt sich auch dann, wenn man Menschen regelrecht in Opferpositionen gefangen hält. Svenja Flaßpöhler ist promovierte Philosophin und Chefredakteurin des „Philosophie Magazin“.
Empathie vermag sogar Gewalt entfachen
Svenja Flaßpöhler erläutert: „Etwa, indem man paternalistisch für andere spricht, sich schützend vor sie stellt und an ihrer statt sagt, welche Begriffe sie diskriminieren. Oder indem man Frauen auf hilflose Wesen reduziert.“ Die dunkle Seite der Empathie offenbart sich überdies in der Gewalt, die sie zu entfachen vermag. Gefühlsansteckungen entfesseln, mobilisieren Massen – im Guten wie im Schlechten. Bezweifelbar ist insofern die These des Evolutionsbiologen Steven Pinker, „dass die Gewalt im Lauf der Geschichte tatsächlich abgenommen hat“.
Die destruktiven Affekte des Menschen verschwinden ja nicht einfach. Vielmehr sind die aufgehoben in einem empathischen Sadismus, der immer subtilere Formen findet. Fritz Breithaupt nennt das Strafen und viele leider alltägliche Verhaltensformen wie das Demütigen, Herabsetzen und Bloßstellen. Die Glorifizierung der Empathie birgt ein weiteres Problem. Svenja Flaßpöhler erklärt: „So beraubt sich das Gattungswesen Mensch entscheidender Selbstschutz- und Abwehrpotenziale, wenn es die Ambivalenz der Gefühle verwirft.“
Jeder Krieg ist grausam und schonungslos
Pointierter: Was, wenn das Geheimnis der menschlichen Resilienz in einem archaischen Lebensdrang läge? In einer unbewussten, an die menschliche Urgeschichte mahnenden Triebkraft, die in Momenten größter Ohnmacht eine drohende Vernichtung verhindert? Svenja Flaßpöhler begibt sich ins Jahr 1915. Wenige Monate zuvor war der Erste Weltkrieg ausgebrochen, der zwanzig Millionen Menschen das Leben kosten wird. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, ist zu diesem Zeitpunkt fast sechzig Jahre alt.
Er lebt in Wien und verfasst unter dem Eindruck der erschütternden Ereignisse zwei Essays, die unter dem Titel „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ erscheinen. Ein weitaus jüngerer, neuzehnjähriger Deutscher befindet sich an der Front in Frankreich. Sein Name: Ernst Jünger. Sigmund Freud schreibt ein paar Monate nach Kriegsbeginn: „Der Krieg, an den wir nicht glauben wollten, brach nun aus, und er brachte die – Enttäuschung. Er ist nicht nur blutiger und verlustreicher als einer der Kriege vorher, infolge der mächtig vervollkommneten Waffen des Angriffs, sondern ebenso grausam, erbittert, schonungslos wie irgendein früherer.“ Quelle: „Sensibel“ von Svenja Flaßpöhler
Von Hans Klumbies