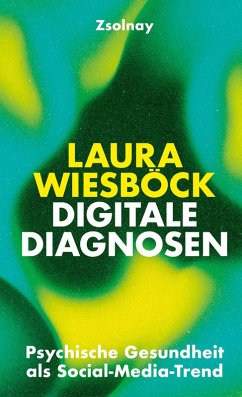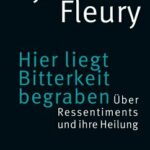Seelische Notlagen sind Teil des Lebens
Laura Wiesböck weiß: „War der Begriff „psychische Gesundheit“ vor nicht allzu langer Zeit noch überwiegend medizinischem Personal vorbehalten, so hat sich die Situation inzwischen drastisch verändert. Die Wahrnehmung von seelischen Erkrankungen ist gesamtgesellschaftlich gestiegen.“ Social-Media-Plattformen sind voll von Inhalten zu psychiatrischen Diagnosen – und das nicht erst seit der COVID-19-Pandemie. Darin zeigt sich ein historisches Kontinuum: Was von wem als pathologischer Zustand verstanden wird, unterliegt laufenden Aushandlungsprozessen. Definitionen von „krank“ und „gesund“ sind keine objektiven Parameter. Sie sind sozial konstruiert, gesellschaftlich vermittelt, unterliegen spezifischen „Moden“ und sind abhängig von unterschiedlichen Interessen und vorherrschenden Werten. Die Erkenntnis, dass psychiatrische Diagnosen auch soziale Konstrukten und keine biologische „Störung“ sein kann, macht den Zustand für diejenigen, die unter Belastungen leiden, jedoch nicht weniger schwerwiegend oder real. Laura Wiesböck ist promovierte Soziologin und leitet die Gruppe „Digitalisierung und soziale Transformation“ am Institut für Höhere Studien Wien.
Die gegenwärtige Kultur ist auf Schmerzvermeidung ausgelegt
Und auch wenn bestimmte seelische Notlagen – wie Lebenskrisen, Phasen der Orientierungslosigkeit, emotionale Verletzungen und persönliche Tiefpunkte – seit jeher Teil des „normalen“ menschlichen Lebens sind, bedeutet das nicht, dass diese nicht schmerzvoll sind oder keine Unterstützung brauchen. Auffallend ist zudem, dass Fragen zur emotionalen Ausgeglichenheit und Funktionalität immer mehr zu Fragen von Gesundheit und Krankheit werden.
Sieht man sich bisherige Analysen über die gesellschaftliche Popularisierung von psychiatrischen Diagnosen an, wird vielleicht der Standpunkt vertreten, dass ökonomische Interessen der Gesundheitsindustrie – „Pharma“ – als treibende Kraft dahinterstünden. Laura Wiesböck fügt hinzu: „Andere Stimmen betonen, unsere gegenwärtige Kultur sei auf Schmerzvermeidung und damit Daueranästhesierung ausgelegt. Auf Social-Media-Plattformen finden insbesondere Ansätze einer psychosozialen Systemkritik Anklang, nach denen der Kapitalismus krank mache.“
Das Selbst ist so fragil und verletzungssensibel wie kaum zuvor
Bisher wenig wurde der Fokus darauf gelegt, dass es in utilitaristischen Gesellschaften außerhalb des krankhaften Settings eigentlich kaum Räume gibt, in denen dysfunktionale Verhaltensweisen und menschliche Gefühle von Verletzlichkeit legitimerweise ausgelegt werden können. Laura Wiesböck stellt fest: „Im Gegensatz zu christlichen Kulturen etwa, in denen es Orte für Leid gibt und dieses sinnbesetzt verwertet werden kann. Und das, obwohl das Selbst immer stärker im Fokus steht und so fragil und verletzungssensibel ist wie kaum zuvor.“
In gläubigen Gesellschaften haben Menschen oft eine höhere Leidensfähigkeit, da sie an eine tiefere Wahrheit glauben, die über das unmittelbare Wohlbefinden hinausgeht – „Jenseits“. Laura Wiesböck ergänzt: „Moderne Ansprüche der Produktivität, Effizienz, Eigenverantwortung und Lustorientierung lassen hingegen wenig Platz für Dysfunktionalität, Phasen der Orientierungslosigkeit oder das Zulassen und Ausleben von emotionalen Schmerz.“ Traurigkeit wird dann weniger als „normale“ menschliche Reaktion auf bestimmte Ereignisse gedeutet, etwa auf eine globale Pandemie, den Verlust einer geliebten Person oder diskriminierenden Erfahrungen, sondern als „Störung“ die behandlungsbedürftig ist. Quelle: „Digitale Diagnosen“ von Laura Wiesböck
Von Hans Klumbies