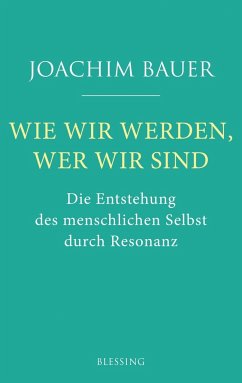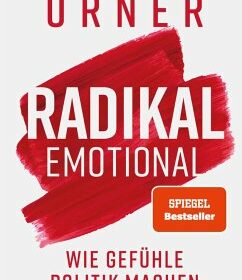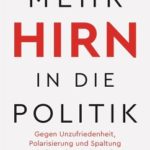Eltern können nicht perfekt sein
Eltern können, auch wenn sie ihr Kind über alles lieben, nicht perfekt sein. Joachim Bauer erklärt: „Alle Eltern kommen, ebenso wie andere Betreuende, irgendwann an ihre Grenzen, müssen dem Kind auch selbst Grenzen setzen und machen gelegentlich „Fehler“. Nicht nur Eltern können nicht perfekt sein, auch die Welt, in die unsere Kinder hineingeboren werden, ist eine mit vielen Mängeln, die sich immer noch auf die Situation von Kindern auswirken und ihnen zahlreiche Frustrationen oder Verletzungen zumuten.“ Einem Kind wohlüberlegt – nicht aus Lust an der eigenen Macht – Grenzen zu setzen, ist kein Trauma, auch wenn dies beim Kind zu Ärger, zu einer Rebellion oder zum Weinen führen sollte. Wichtig ist, dem Kind das eigene Vorgehen zu erklären. Prof. Dr. Med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Arzt.
Das Selbst ist immer Subjekt und Objekt
Diese Erklärung der Eltern hat durchaus nicht immer zur Folge, dass sich die Akzeptanz für eine getroffene Entscheidung auf Seiten des Kindes dadurch erhöht. Auch davon sollte man sich aber nicht irritieren lassen. Die begleitende Erklärung bleibt trotzdem außerordentlich wichtig, denn sie ermöglicht es dem Kind – in der Regel geschieht dies erst im Nachhinein –, das elterliche Votum zu internalisieren und damit den eigenen inneren Integrator zu stärken. Indem das Selbst des Kindes beginnt, eine aktive Rolle zu spielen, beteiligt es sich jetzt zunehmend an Aufgaben, die in den ersten Lebensmonaten noch ausschließlich bei den Bezugspersonen „outgesourct“ waren.
Joachim Bauer weiß: „Das menschliche Selbst bleibt das gesamte Leben hindurch immer beides: agierendes Subjekt und betroffenes Objekt. Es ist einerseits der Akteur, der sagt: Das bin ich. Andererseits ist es Adressat von Ansagen, Botschaften, Unterstützungsangeboten und Bedrohen, die nicht einfach an seiner Außenwand abprallen, sondern eindringen können und – wie Suggestionen – entweder zu einem Teil des Selbst werden oder eine Gegenreaktion auslösen können.“
Das Selbst ist nicht machtlos
Vieles, da das meiste geschieht dabei unmerklich oder unbewusst. Das Selbst ist jedoch nicht machtlos. Es spürt nicht nur, welche Menschen und welche Ansagen ihm guttun oder nicht behagen, welche seine Kräfte vermehren oder schwächen. Es hat den Selbst-Beobachter an seiner Seite, der es ihm ermöglicht, sich über sich, über die eigenen Motive und über die Motive anderer Gedanken zu machen. Sein Sensorium und seine Analyseinstrumente befähigen das Selbst, Einfluss darauf zu nehmen, mit welchen Menschen es sich umgibt.
Indem es auf die Menschen zugeht, auf sie reagiert und Erlebnisse interpretiert, selektiert und zusammenfügt, beteiligt sich das Selbst an seiner fortwährenden, niemals abgeschlossenen Selbstkonstruktion. Joachim Bauer stellt fest: „Damit ist der Rahmen beschrieben, der es uns erlaubt, nicht traumatische, also zu bewältigende äußere Einwirkungen von traumatischen Erlebnissen zu unterscheiden. Traumatische Erfahrungen unterscheiden sich von nichttraumatischen dadurch, dass Traumata da Selbst des Opfers gewaltsam entmachten und seine Rolle als Wächter der eigenen Unversehrtheit und als Integrator dessen, was erlebt wird, berauben.“ Quelle: „Wie wir werden, wer wir sind“ von Joachim Bauer
Von Hans Klumbies