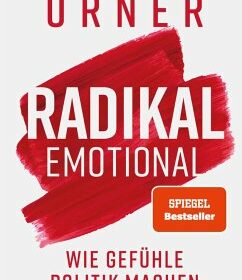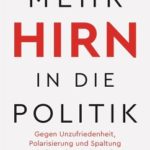Erziehung ist ein Phänomen der Generationen
Der Wandel des Erziehungsstils ist notwendigerweise in den Verarbeitungschancen begründet, die jeder Generation zur Verfügung stehen sowie ihren gemeinsamen Erlebnissen und den daraus entstehenden Sichtweisen auf die Welt. Rüdiger Maas fügt hinzu: „Aber nicht nur: Wichtig ist auch, dass man auf den Spuren des Erziehungsstils sogenannte Interaktionseffekte berücksichtigt: Unter einem Interaktionseffekt versteht man in der Generationenforschung die Beeinflussung einer Generation durch eine andere.“ Was also für Eltern wichtig ist, kommt wiederum von ihren eigenen Eltern und wird sich über die Erziehung auch auf ihre Kinder übertragen und auswirken. Erziehung ist also ein Phänomen der Generationen. Die meisten Kinder, die in den 1940er-Jahren groß wurden, hatten in ihrer Kindheit nicht viel. Rüdiger Maas studierte in Deutschland und Japan Psychologie. Er ist Gründer und Leiter eines Instituts für Generationenforschung.
Die Nachkriegsgeneration war die nachhaltigste aller Generationen
Und das wenige, dass sie hatten gaben sie nicht so einfach weg. Die Kriegs- und Entbehrungserfahrung war für die meisten so prägend, dass sie noch lange danach so sparsam lebten. Rüdiger Maas stellt fest: „Ihre Kinder wurden erwachsen, und längst gehörten Not und Knappheit der Vergangenheit an, doch Toast, Kuchen oder die Reste vom Mittagessen wurden nach wie vor eingefroren oder weiterverwendet, wenn etwas davon übrigblieb.“
Auch war es normal, dass es am nächsten Tag das Gleiche gab. Rüdiger Maas betont: „Etwas wegzuschmeißen, was noch verwertbar war, kam nicht in Frage und Menschen, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, auch heute noch nicht in den Sinn.“ Wenn man so will, war diese Generation die nachhaltigste aller Generationen, gemessen am Verschleiß von Essen und Eigenbedarf. Auch die Bindung zwischen Eltern und Kindern war geprägt durch den Krieg und die folgenden Jahre.
Die Kinder der Nachkriegsgeneration werden auch die „stille Generation“ genannt
Dazu gehörte, dass über die eigenen Gefühle nicht gesprochen wurde. Im Vordergrund standen der Wunsch und die Notwendigkeit, irgendwie durchs Leben zu kommen und den Alltag so gut es ging zu meistern. Rüdiger Maas ergänzt: „Unangenehmes, vor allem die traumatische Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, wurde oftmals ausgespart: die Fronterlebnisse des Vaters, die Kriegserlebnisse der Mutter, das Überleben und das Leben danach.“
Gleichzeitig waren die Eltern von dem Wunsch beseelt, dass die nächste Generation so etwas niemals erleben sollte. Rüdiger Maas weiß: „Vieles wurde ausgeschwiegen, ausgesetzt oder umgangen, vieles durch Arbeit verdrängt. Fleißig sein und wenig fordern, das waren die Tugenden der Eltern, die ihre Nachkommen übernahmen.“ Die Kinder der Nachkriegsgeneration werden auch die „stille Generation“ genannt. Sie sind geprägt von Verzicht, materiell wie immateriell, von Disziplin und Diskussionsarmut. „Ich dulde keine Widerworte“ war ein häufiger Satz deutscher Väter in dieser Zeit. Quelle: „Generation lebensunfähig“ von Rüdiger Maas
Von Hans Klumbies