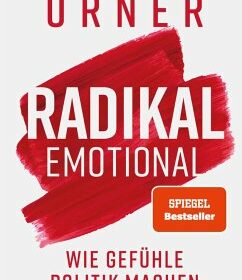Vertrauen setzt Vertrauenswürdigkeit voraus
Vertrauen entsteht nicht, weil es wichtig ist. Mit anderen Worten, nur weil man es braucht oder weil es fehlt, tritt es nicht in Erscheinung. Man schenkt Vertrauen auch nicht, weil es wichtig ist. Martin Hartmann erklärt: „Wir schenken Vertrauen, wenn jemand vertrauenswürdig ist. Gleiches gilt für die Liebe. Liebe ist wichtig, aber wir lieben nicht, weil es wichtig ist, sondern weil wir jemanden für der Liebe würdig erachten oder weil wir uns Hals über Kopf verlieben.“ Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit schaffen sich nicht von selbst, wenn sie benötigt werden. So freundlich sind sie nicht. Man muss sie schon selbst durch seine Praktiken ins Leben rufen. Einstellungen des Vertrauens sind immer eingebettet in ein System anderer Werte und Einstellungen. Martin Hartmann ist Professor für Praktische Philosophie an der Universität Luzern.
Vertrauen ist kein eigenständiges Phänomen
Vertrauen steht nie für sich selbst. Verdinglicht wird Vertrauen, wenn man es isoliert, wenn man so tut, als sei es ein ganz und gar eigenständiges Phänomen mit einer eigenen Normativität. Diese Perspektive ist falsch. Die Qualität des Vertrauens hängt immer an den weiteren Werten, die sich im Vertrauen verwirklichen. Und es hängt etwas daran, ob man jemand sein will, dem Vertrauen wichtig ist, weil es Freiheitsräume schafft, die auf vielfältige Weise produktiv sein können.
Martin Hartmann stellt fest: „Wir können nicht einfach darauf vertrauen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die diese Werte – Freiheit, Kreativität, Produktivität – hochhält. Wir müssen schon selbst dafür sorgen, dass ein solches Vertrauen gerechtfertigt sein kann.“ Gesellschaften sind unendlich komplexe Strukturen, die auf tausend kleinen und tausend großen Faktoren beruhen. Martin Hartmann glaubt nicht, dass Empathie Gesellschaften zusammenhält. Er sieht darin eher ein weiteres Modethema der Philosophie.
Ungewissheit gehört zum Vertrauen
Man kann nicht einfach vom Vertrauen an sich reden, als hätte es keine Gegenstände, auf die es sich richtet. Manche Analysen thematisieren ausschließlich rationales Vertrauen, das zu Recht vergeben wird. Was rational heißt, muss dann natürlich ausbuchstabiert werden, was in der Regel auch passiert. Problematisch an diesen Ansätzen ist, dass sie gelegentlich dazu neigen, das irrationale Vertrauen gar nicht als Vertrauen zu bezeichnen. Sie definieren die dunklen oder unangenehmen Aspekte des Vertrauens einfach weg.
Wie vernünftig es ist, anderen zu vertrauen, weiß man meist erst, wenn es zu spät ist. Wenn die Philosophie dann sagt: „Das, was du da gemacht hast, verdient den Namen Vertrauen nicht“, hilft das einem Menschen naturgemäß nicht weiter. Martin Hartmann weiß: „Diese Ungewissheit gehört zum Vertrauen und kann nicht durch eine noch so genaue Analyse des Begriffs ausgeschlossen werden.“ Man muss vertrauen, um festzustellen, ob es richtig war zu vertrauen. Erst die erfahrene Praxis des Vertrauens rechtfertigt die eigene Einstellung. Quelle: „Vertrauen“ von Martin Hartmann
Von Hans Klumbies