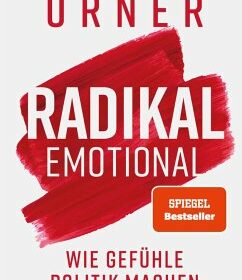Charles Pépin rät von der Liebessymbiose ab
Es gibt eine Vorstellung der Liebe als Konstruktion, als Erkundung des Unterschieds des Anderen. Diese ist Lichtjahre von dem entfernt, was Charles Pépin „Liebessymbiose“ nennen möchte. Im letztgenannten Fall, der häufig in der Jugend als Ideal gilt, sehnt man sich danach, eins zu sein, eine Symbiose zu bilden, das Gleiche zu fühlen, die gleichen Wünsche und Vorlieben zu haben, das gleiche Leben zu führen, überall und immer auf einer Wellenlänge zu sein. Charles Pépin fügt hinzu: „Und wir träumen von dieser Verschmelzung als der höchsten Form der Liebe.“ Meistens spricht man dann in der Wir-Form, statt „ich“ zu sagen. Man stellt sich gerne als Paar dar, statt als zwei Individuen, und findet diese Vorstellung schön und romantisch. Charles Pépin ist Schriftsteller und unterrichtet Philosophie. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.
Symbiotische Beziehungen sind meistens ungleich
Dabei ist doch gerade, was ein Individuum interessant macht, dass es es selbst ist, einzigartig in seiner Rätselhaftigkeit und Vielschichtigkeit. Und wenn dieses Individuum das Glück hat, geliebt zu werden, dann aus diesem Grund: als einzigartiges Wesen, dessen Geheimnis den Verliebten anzieht. Wenn es aber mit dem Anderen verschmilzt, hinter der Beziehung verschwindet, genauso fühlt und denkt wie der Andere, verliert es seine Einzigartigkeit, seinen Sinn für Kritik und gerade dadurch seinen Reiz.
Charles Pépin gibt zu bedenken: „Hinzu kommt, dass symbiotische Beziehungen meistens ungleich sind. Einer der beiden verschwindet mehr als der andere. Und wenn beide nur noch eins sind, dann nur deswegen, weil der eine sich durchgesetzt hat und der andere sich zurückzieht.“ Dieser Rückzug erfolgt manchmal mit dessen „Zustimmung“. Wenn der eine sich nicht ausreichend liebt und von dem anderen so abhängig ist, dass er nicht allein leben kann, wird die Beziehung diesen Rückzug verstärken.
Die Rätselhaftigkeit des Anderen führt zum Staunen
Gegen diese Vorstellung der Liebessymbiose mit ihren etwaigen verheerenden Folgen unterbreitet Alain Badiou eine wesentlich zeitgenössischere Vision von Liebe, die ebenfalls romantisch ist, aber in einem anderen Sinn. Da geht es nicht um Selbstaufgabe oder Selbstvergessen in der völligen Verschmelzung, sondern um das viel konkretere, wirksame, Tag für Tag erneuerte Staunen angesichts der Rätselhaftigkeit des Anderen. Hier bleibt der Andere ein anderer.
Man sollte sich also in Acht nehmen vor Ausdrücken und Wendungen, die zwei Menschen scheinbar mit einander verschmelzen lassen und als Paar darstellen. Charles Pépin warnt: „Wir sollten uns vor diesem „wir“ in Acht nehmen, das unseren wunderbaren Unterschied zu negieren droht.“ Dagegen sollte man so liebevoll wie möglich den Schatz der Andersheit hüten, statt seinen Glanz durch das vorliebgenommene oder abgeschmackte und immer ein bisschen karikaturenhafte „Wir“ zu trüben. Quelle: „Kleine Philosophie der Begegnung“ von Charles Pépin
Von Hans Klumbies