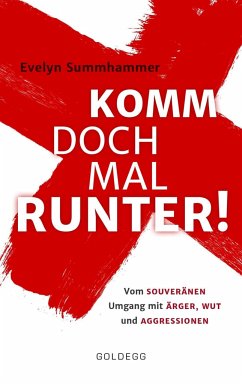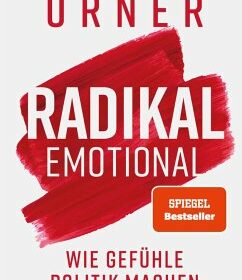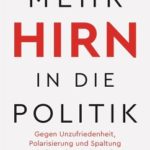Menschen meiden schlechte Gefühle
Es treiben bissige Wörter im endlosen Informationsstrom, der die vielen sogenannten Kanäle täglich überspült. Sebastian Herrmann stellt fest: „Taucht so ein Beißwort auf, springen sehr viele, vielleicht sogar eine wachsende Zahl von Menschen hastig aus dem Informationsstrom, klinken sich aus und gehen in Deckung. Unerwünschte Informationen vermeiden fast alle Menschen so gut es nur geht.“ Die Faustregel lautet, je hitziger ein Thema diskutiert wird, desto mehr Anlässe gibt es, in Deckung zu gehen. Menschen konsumieren am liebsten Informationen, die ihre Weltsicht – scheinbar – bestätigen, und meiden solchen, die diese infrage stellen. Das ist lange bekannt und liegt auf der Hand. Auf die Frage nach dem Warum, geben Psychologen bisher allerdings nur eine grobkörnige Antwort: Es löst Aversionen aus, sich mit Gegenpositionen zu beschäftigen, und schlechte Gefühle meide der Mensch.
Jeder sollte seine Ansichten hin und wieder aktualisieren
Julia Minson von der Harvard University und Charles Dorison von der Nothwestern University diskutieren nun in einem Beitrag in „Current Opinion in Psychology“ was genau denn diese schlechten Gefühle weckt. Die stärksten Argumente sprechen aus Sicht der Psychologen dafür, dass die Menschen einem „naiven Realismus“ anhingen, also der Ansicht, dass ihre Version der Wahrheit selbstverständlich valide und objektiv sei. Wer die Dinge anders sieht, müsse also wenigstens dumm, wenn nicht gar niederträchtig sein.
Jegliche Beschäftigung mit einer anderen Sicht bedeute also verschwendete Geistesmühe, und die offensichtliche Borniertheit der anderen erzeuge nur Frust oder Zorn, argumentieren die Psychologen. Jedoch wäre es sehr hilfreich, offen für neue Evidenz zu seine und die eigenen Ansichten entsprechend zu aktualisieren. Dummerweise wirft sich da entweder die eigene Weltsicht in den Weg, oder die Brüllaffen der grundangefassten Öffentlichkeit schreien einen zornig nieder.
Menschen ziehen die Ruhe der Wahrheit vor
Sebastian Herrmann blickt zurück: „Der Mensch müsse sich eben für eines entscheiden, für die Wahrheit oder die Ruhe, beides auf einmal sei nicht im Angebot, hat einmal der US-amerikanische Schriftsteller Ralph Waldo Emerson geschrieben.“ Vor die Wahl gestellt, entscheiden sich die Menschen eher für die Ruhe als für die Wahrheit, wie zum Beispiel 2009 eine Metaanalyse um William Hart im Fachjournal „Psychological Bulletin“ gezeigt hat. Um scheinbar recht zu behalten, belügen oder täuschen sich die Menschen also selbst.
Die lange Zeit dominante Erklärung, so führen Minson und Dorison in ihrem Beitrag aus, bezieht sich auf die Theorie der kognitiven Dissonanz, die in der Sozialpsychologie Leon Festinger 1957 formuliert hat. Der Mensch betrachte sich selbst demnach als intelligentes, moralisches und vernünftiges Wesen. Dieses Selbstbild verteidige das Individuum zum Beispiel, indem es Gegenpositionen ignoriere, die dieses ankratzen könnten. „Kognitive Dissonanz entsteht, wenn das Selbstbild bedroht wird“, scheiben Minson und Dorison. Quelle: „Haltet alle den Mund!“ von Sebastian Herrmann in der Süddeutschen Zeitung vom 22. September 2022
Von Hans Klumbies