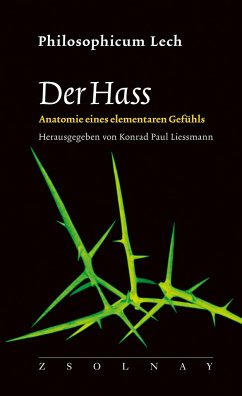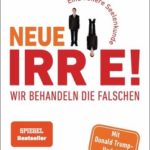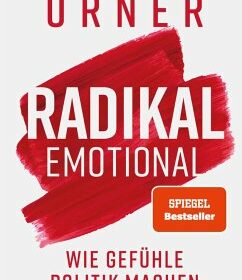Liebe und Hass können ineinander übergehen
Christoph Demmerling schreibt: „In der Geschichte der Philosophie findet sich eine Reihe von Analysen, dies geht für die klassischen Affektlehren, etwa bei René Descartes, Baruch de Spinoza oder David Hume, gilt aber beispielsweise auf für Thomas von Aquin, die den Hass in einem Atemzug mit der Liebe nennen.“ Beide Phänomene gelten als konträr, als Gefühle, die einander gegengesetzt sind. Gut und zuträglich, schlecht und schädlich, so lauten die einschlägigen Charakterisierungen. Die Hinweise auf die Schädlichkeit treffen sich mit Christoph Demmerlings Überlegungen zur Normalform des Hasses. Liebe und Hass können ineinander übergehen oder sich miteinander verbinden. Entgegengesetzt sind diese Gefühle zunächst einmal in dem einfachen Sinn, dass die hedonistischen Valenzen, die mit ihnen verbunden sind, gegenläufig sind. Univ.-Prof. Dr. Christoph Demmerling lehrt Philosophie mit dem Schwerpunkt Theoretische Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
Liebe und Hass können von großer Intensität sein
Liebe ist mit Lust, Hass mit Unlust verbunden. Christoph Demmerling erklärt: „Dass beide Gefühle häufig in einem Atemzug zur Sprache gebracht werden, hängt sicher auch damit zusammen, dass sie beide von großer Intensität sein können und ihre Objekte als solche von großer Bedeutsamkeit erfahren werden.“ Wer Hass theoretisch verstehen möchte, tut gut daran, ihn im Zusammenhang mit anderen feindseligen und aggressiven Gefühlen zu betrachten.
Hass als aversives Gefühl geht mit Feindschaft und Ablehnung einher, er impliziert dezidiert negative Wertungen. Personen oder Gruppen werden aus einem bestimmten Anlass gehasst. Hass hat Gründe. Christoph Demmerling erläutert: „Verletzungen, Demütigungen, durch andere Personen erfahrene Bedrohungen und Einschränkungen sind es, die häufig den Anlass zur Ausbildung von Hassgefühlen geben.“ Hass kann nicht nur durch die genannten Erfahrungen hervorgerufen und verursacht werden, sondern auch dadurch, dass Hass durch den Verweise auf diese Erfahrungen legitimiert und gerechtfertigt wird.
In der Regel ist der Hass moralisch gebrandmarkt
Christoph Demmerling unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen kausal wirksamen Verursachungsbeziehungen – Ursachen- und rational wirksamen Rechtfertigungsbeziehungen – Gründen. Wie ist es um die Rechtfertigung von Hassgefühlen bestellt? Rechtfertigungen für den Hass mögen zwar in der Perspektive des Hassenden als belanglos angesehen werden, aber aus der Warte Außenstehender kann durchaus unklar bleiben, ob Gründe für den Hass tatsächlich bestehen oder lediglich vorgegeben werden.
Ganz unabhängig davon jedoch zeigt sich, dass selbst ein Gefühl wie der Hass, der häufig als durch und durch irrational gilt, interne Rationalitätsbedingungen besitzt, gerechtfertigt und seinerseits als Grund für Handlungen angeführt werden kann. Christoph Demmerling fügt hinzu: „Als Reaktion auf Verletzungen oder Bedrohungen scheint der Hass nachvollziehbar, was nicht unbedingt heißt, dass er dadurch Akzeptanz gewinnt.“ In der Regel wird der Hass jedoch unter Irrationalitätsverdacht gestellt und moralisch gebrandmarkt. Quelle: „Feindselige Gefühle“ von Christoph Demmerling in Philosophicum Lech „Der Hass“ von Konrad Paul Liessmann (Hg.)
Von Hans Klumbies